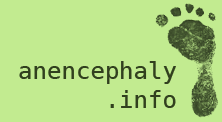Luise
17.4.2002 - 18.4.2002
Wir haben 5 gesunde Kinder. Der älteste wird 16, die Jüngste ist 7 Jahre alt. Als
wir den Kindern mitteilten, dass wir noch ein Baby erwarteten, war die Freude gross.
In den ersten 4½ Monaten verlief alles wie bei den anderen Schwangerschaften.
Kurz vor Weihnachten hatte ich einen Termin bei meinem Frauenarzt. Es war die
21. Schwangerschaftswoche, in der eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt
werden musste. Mein Mann Johann hatte an jenem Tag frei – es war sein erster
Urlaubstag. Wir hatten vor, nach der Untersuchung noch die letzten Vorbereitungen
für Weihnachten zu treffen – doch es kam ganz anders...
Jenen Tag und die darauffolgende Nacht werden wir so schnell nicht vergessen können.
Als der Arzt die Grösse der einzelnen Körperteile des Kindes durch den Ultraschall
ausmessen wollte, wurde er immer ernster. Es dauerte auch länger als sonst. Irgendwie
hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung sei. Als ich zum ersten Mal fragte,
ob etwas nicht in Ordnung sei, wich der Arzt meiner Frage aus, und meinte nur, dass
ich mich anziehen solle. Als ich kurz darauf im Sprechzimmer dem Arzt gegenüber sass,
und mit Tränen in den Augen meine Frage wiederholte, antwortete er mir, und sagte,
dass das Kind wohl eine schwere, seltene Missbildung habe. Er telefonierte sofort
mit dem Krankenhaus, wo es ein besseres Ultraschallgerät gibt. Der Arzt drückte mir
zum Abschied die Hand und meinte: "Euch stehen schwere Weihnachtstage bevor!"
Ich weiss jetzt nicht mehr, wie ich es geschafft habe, mit dem Auto nach Hause zu
kommen. Das Herz blutete, die Augen waren voller Tränen, und im Inneren waren so
viele ungewisse Fragen.
Mein Mann erwartete mich schon zu Hause; ihm war es seltsam lang vorgekommen.
In seinen Armen konnte ich mich richtig ausweinen. Er verstand erst gar nicht,
was los war, weil ich kein einziges Wort aus mir herausbringen konnte. Er erfuhr
es aber noch früh genug, nämlich als wir dem Ultraschallspezialisten gegenüber
sassen. Ich wurde von drei Ärzten untersucht (Ultraschallspezialist, Professor
und der Oberarzt der Frauenklinik). Alle konnten uns nur das Gleiche sagen:
"Euer Baby hat die schwere Missbildung, Anenzephalie. Es wird kurz nach der Geburt
sterben."
Wir sollten uns überlegen, ob es einen Sinn habe so ein Kind auszutragen.
In unserer Zeit gebe es genug Möglichkeiten, dem Allem ein schnelles Ende zu machen.
Aber unsere Antwort darauf war ganz klar, ohne dass wir zu überlegen brauchten. Wir
sagten den Ärzten, dass wir nie ein Kind töten würden, denn Gott ist es, der über
Leben und Tod zu entscheiden hat, und dass Gott uns auch in dieser Zeit beistehen werde.
Uns wurden einige Bilder von Kindern mit Anenzephalie gezeigt, vieles über diese
Krankheit erklärt und über das Risiko, das wir eingingen. Ich hörte aufmerksam zu,
konnte es aber nicht richtig realisieren. Bei uns war doch immer alles in Ordnung
gewesen, alle vorherigen Schwangerschaften waren normal verlaufen, und die Kinder
waren alle gesund und normal. Ich hatte noch nie etwas von so einer Krankheit gehört
und konnte es mir auch ziemlich schlecht vorstellen, vor allem, weil es mein Kind war,
das diese Krankheit nun hatte.
Auf der Heimfahrt und zu Hause wollten die Tränen kein Ende nehmen. Unsere Kinder waren
schon zu Hause und verstanden sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. Wir beteten
zusammen und baten, dass Gott uns doch beistehen möge, uns ganz nahe sei, und uns die
Kraft schenke auch dieses Kind aus seiner Hand anzunehmen. Wir telefonierten mit unseren
Eltern und Geschwistern. Abends kamen sie alle zu uns; wir weinten und beteten zusammen.
Das Ganze war zwei Tage vor Weihnachten, wo wir uns doch freuen wollten, dass Gott
uns seinen Sohn Jesus geschenkt hat, der auch gerade für solche Menschen wie uns auf
die Erde gekommen ist. Es ist schwer, sich in solchen Zeiten zu freuen. Aber Gott war
uns auch in jener Zeit ganz nahe. In der ersten Nacht konnten Johann und ich kein Auge
zumachen, es war die schwerste Nacht in jener Zeit. Wir knieten einige Male nieder und
beteten. Wir beschlossen, nicht um Heilung zu beten, sondern, dass alles so geschehe,
wie Gott es haben will.
Den Rest der Schwangerschaft wollte ich einfach ganz normal verleben, genauso, wie auch
bei bei den anderen Kindern. Das Baby bewegte sich sehr viel, und ich wollte diese
Zeit mit dem Kind so richtig geniessen, obwohl ich oft geweint habe.
Der Geburtstermin war für den 4. Mai vorgesehen, aber bereits in der 38. Schwangerschaftswoche
fingen bei mir die Wehen an. Ich spürte, dass es schon bald soweit sein müsste. Ich hatte
Angst vor dem, was jetzt auf mich zukommen würde. Fragen über Fragen standen vor mir:
"Wird unser Kind noch etwas leben?" "Wird es auch weinen oder trinken können wie die anderen?"
"Wie werde ich mit der offenen Wunde am Kopf als Mutter umgehen können?" "Wie wird man mich
im Krankenhaus behandeln?"
In den letzten Nächten fand ich kaum Schlaf, weil so viele Fragen in mir hochkamen, so viele
Sorgen vor dem, was auf mich zukommen würde. Ich spürte, wie abhängig ich von Gott bin. Er
konnte mich am Besten verstehen und in den Gebetsgemeinschaften mir ihm konnte ich mich so
richtig ausweinen, konnte ihm alle meine Not sagen. Mein Mann und meine Kinder waren so
besorgt um mich, erwiesen mir viel Liebe und versuchten mich zu trösten – es tut mir
heute noch so gut, wenn ich an jene Zeit zurückdenke.
Am 17. April war es dann soweit. Mein Frauenarzt hatte empfohlen, die Geburt früher einzuleiten,
weil es in den meisten Fällen mit Babies mit Anenzephalie nicht von alleine losgeht. Um 8:00
Uhr fuhren wir schon ins Krankenhaus. Ich wurde noch einmal untersucht, der Professor schaute
auch noch mal vorbei und wünschte mir alles Beste. Die Ärzte und Hebammen waren alle sehr
nett uns gegenüber. Keiner fragte, warum oder wieso wir die Schwangerschaft nicht vorzeitig
abgebrochen haben. Gleich morgens kam noch die Kinderärztin, um mit uns zu besprechen, wie
wir uns alles wünschen und vorstellen, wenn das Kind erst da sein würde. Wir äusserten unseren
Wunsch, das Kind in den Händen halten zu dürfen. Wir wollten auch keine künstliche Beatmung für
das Baby. Wenn Gott vorgesehen hat, dass es lebensunfähig ist, wollen wir es aus Gottes Hand
annehmen. Die Ärztin erzählte uns auch, dass es in diesem Krankenhaus seit 10 Jahren keine
Geburt eines Kindes mit Anenzephalie mehr gegeben habe.
Drei Hebammen wechselten sich, bis unsere Tochter endlich da war. Ich kann zurückblickend nur
danken. Wir haben im Krankenhaus sehr viel Liebe, Mitgefühl und Mitleid verspürt. Gott hat
unsere Gebete erhört. Für uns wurde sehr viel gebetet. Die Familie, Kinder, Eltern, Geschwister,
Freunde und die ganze Gemeinde beteten für uns.
Um 23:47 Uhr kam unsere Tochter Luise zur Welt. Es war ganz still im Kreissaal, nur ich weinte,
weil ich wusste, dass jetzt alles Wirklichkeit werden würde, was so lange Monate noch vor uns lag.
Bevor ich sie in den Armen halten durfte, wurde ihr ein Tuch übers Köpfchen gewickelt. Noch heute
spüre ich ihren warmen Körper in meinen Händen. Ihr Gesichtchen war dunkelrot, und sie fing auf
einmal an, leise zu weinen, aber sie lebte, und das war mir so wertvoll.
Ich sah nur auf das Gesichtchen unserer Tochter und musste weinen. Auch bei Johann liefen die
Tränen. Auch die Hebamme, die daneben stand, und alles mit ansah, wusch sich die Tränen ab.
Es schien, als ob die Zeit um uns herum still stand. Luises Augen blieben zu, das Weinen hörte
auch bald auf. Stillen konnte ich sie ja nicht, da sie ja nicht schlucken konnte. Die Wunde am
Kopf blutete, ihre Fingerchen wurden immer kälter und eines nach nach dem anderen ganz blau.
Wir durften Luise in diesen Stunden, die sie lebte, immer auf den Armen halten, und wir sahen,
wie ihre Atmung immer unregelmässiger wurde, nur ihr Herzchen war noch stark. Wir hielten unsere
Tochter in den Armen und beteten zu Gott, er möge Luise zu sich nehmen, da wir mit Gottes Wegen
einverstanden waren.
Um 14:15 Uhr hörte Luise auf zu atmen.
Wir machten noch etliche Fotos und Fussabdrücke.
Wir sind traurig und dankbar zugleich, und wir wissen, dass unsere Tochter nun sicher im Himmel
ist. Es tröstet uns, dass wir die Hoffnung haben, sie einmal im Himmel wieder zu sehen, wo es
keine Krankheit mehr geben wird, und wo wir ewig den Herrn loben werden. Ich muss zugeben, dass
es immer noch Tage gibt, an denen ich weinen muss, wenn ich an Luise denke, aber ich bin dankbar,
dass wir keine Schuldgefühle oder Bedauern haben müssen. Gott war uns in dieser ganzen Zeit sehr
nah und ich kann bestätigen, dass Gott bei Leiden nicht vorbei hilft, sondern er hilft hindurch.
Johann und Anna Martens, Deutschland
geschrieben im Mai 2002
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 25.02.2019